 Grundsätzlich bin ich ja für Fußgängerzonen, vor allem in den historischen Stadtzentren überall im freien Westen. Beispielsweise nicht mehr durch die Wiener Kärntner Straße, welche übrigens seit 1974 Fußgängerzone ist, spazieren zu können, ohne von Autos oder Rad-Rowdys (wobei dies immer mehr zunimmt) gerempelt zu werden, wäre inzwischen undenkbar. Und das ist gut so.
Grundsätzlich bin ich ja für Fußgängerzonen, vor allem in den historischen Stadtzentren überall im freien Westen. Beispielsweise nicht mehr durch die Wiener Kärntner Straße, welche übrigens seit 1974 Fußgängerzone ist, spazieren zu können, ohne von Autos oder Rad-Rowdys (wobei dies immer mehr zunimmt) gerempelt zu werden, wäre inzwischen undenkbar. Und das ist gut so.
Fußgängerzonen bieten unersetzbare Lebensqualität für Anrainer und Touristen: Selbstverständlich. Doch die besten Fußgängerzonen bieten zwar Geschäfte jeglicher Art, dies steht jedoch nicht im Vordergrund: gerade in der österreichischen Hauptstadt steht die sprichwörtliche Wiener Gemütlichkeit im Vordergrund: man genießt es als Einheimischer oder Tourist, über die breite Kärntner Straße, den Graben und den Kohlmarkt zu wandeln und man genießt die große Geschichte dieser Stadt, welche vor allem von Jahrhunderten Monarchie geprägt wurde und deren prachtvolle Bauten auch heute noch Bewunderung bei Besuchern aus aller Welt auslösen. Das Zentrum Wiens (der erste Bezirk) und so auch jeder anderen historischen Stadt sollten daher auch weitgehend autofrei bleiben.
Die Mariahilfer Straße in Wien zwischen 6. und 7. Bezirk hingegen war nie historisches Zentrum der Stadt, sondern seit Jahrhunderten eine Verkehrstraße Richtung Westen. Und 1870 nahm auf dieser Strecke auch der erste Wiener Straßenwagen (Auto-Vorläufer) seinen Betrieb auf. Und selbst Kaiser Franz Joseph befuhr regelmäßig diese auf dem Weg von der Hofburg nach Schönbrunn und setzte durch, dass selbst die damalige Straßenbahn Nachrang hatte.
Anstatt also die Mariahilfer Straße, die seit jeher Verkehrsstraße war, für den Verkehr zu sperren, wäre eher eine Sperre des historischen Wiener Rings um den ersten Bezirk herum mit seinen prachtvollen Bauten geschichtlich und touristisch sinnvoll.
Ergänzt sei, dass es nur eine wirkliche Befragung der Anrainer und der direkt Betroffenen, der Wirtschaftstreibenden, gibt, die ein klares Nein zur Fußgängerzone in Mariahilf ergibt. Dennoch ideologische Ziele und eigene Prestigeprojekte einfach auf Kosten der Steuerzahler gegen den Willen der Bevölkerung (dass an der Befragung nur wenige teilnahmen, ist kein Gegegenargument, sondern wohl auf die zunehmende Resignation der Leute zurückzuführen: die da oben machen eh, was sie wollen) umzusetzen, spricht Bände über das demokratische Denken der dafür Verantwortlichen Grünen in der Wiener Stadtregierung.
Früher mal standen die Grünen für Ideale, für Basisdemokratie und für Mitbestimmung der Bürger. Heute regieren sie und setzen noch egoistischer ihre eigenen Projekte um als die so genannten “Alt”-Parteien. Die Betroffenen einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen und dann einen “Dialog” zu beginnen, wenn man eh alles schon umgesetzt hat, was man selber will, zeigt, wie ausgerechnet die Wiener Grünen (ein böses Omen auch für eine eventuelle Regierungsbeteiligung der Grünen in der Bundesregierung) die Demokratie verhöhnen. Dass sich nun selbst die Linienbusfahrer aus Sicherheitsgründen weigern, durch die Fußgängerzone zu fahren, zeigt ebenfalls, wie unreif und engstirnig dieses Maria Vassillakou-”Denkmal” in Wien in Wirklichkeit ist.
Die aktuelle “neue Mariahilfer Straße” ist zum Scheitern verurteilt, weil das Konzept einfach nicht gut durchdacht ist: es wird zu noch mehr sinnlosen Staus und in Folge zu massiver Verärgerung führen: die Autofahrer werden sich nach diesen Erfahrungen hüten, je wieder in der Mahü (Mariahilfer Straße) einzukaufen. Also wenn man schon neue Verkehrspläne hat, sollte man Nägel mit Köpfen machen, also eine grundsätzliche, wirklich sinnvolle Lösung (und zwar nicht nur für jene Bezirke, wo die Grünen regieren) finden und umsetzen. Also bevor man Straßen sperrt, sollte man zuerst mal die betroffene Bevölkerung davon überzeugen, dass ein neues Verkehrskonzept notwendig ist und dafür auch eine breite Mehrheit dafür gewonnen haben.
Ist dies gelungen, sind also die Betroffenen (Anrainer und Wirtschaft) mehrheitlich für eine Fußgängerzone Innere Mariahilfer Straße -eine Idee, der ich unter gewissen Voraussetzungen sogar was Positives abgewinnen könnte- dann gilt es, eine Gesamtlösung, ein sinnvolles Verkehrskonzept nicht nur für zwei “grüne” Bezirke, sondern für die gesamte Stadt zu erstellen, welche nicht dazu führt, dass alle anderen Straßen stadtauswärts Richtung Westen noch mehr in Verkehr und Staus ersticken, als dies jetzt der Fall ist:
 A) Wenn schon, dann sollte man gesamte Innere Mariahilferstraße vom Ring bis zum Westbahnhof zur Fußgängerzone umfunktionieren, und zwar ohne Quermöglichkeiten, außer für den Linienbus. Und der Linienbus muss immer Vorfahrt haben!
A) Wenn schon, dann sollte man gesamte Innere Mariahilferstraße vom Ring bis zum Westbahnhof zur Fußgängerzone umfunktionieren, und zwar ohne Quermöglichkeiten, außer für den Linienbus. Und der Linienbus muss immer Vorfahrt haben!
B) Liefertätigkeit sollte mit wenigen Ausnahmen nur zwischen 4.00-10.00 Uhr möglich sein.
C) Und ganz wichtig: In der Praxis gibt es kein konfliktfreies Miteinander zwischen Fußgängern und Radfahrern: Also wenn schon, dann dreiviertel der Straßenbreite für Fußgänger und der Rest als Radweg. Die unzähligen sich um keine Verkehrsregeln kümmernden Rad-Rowdys sollten ihren eigenen Radweg haben und aus Sicherheitsgründen keinesfalls den Fußgänger-Bereich nützen dürfen.
Eine Aufteilung der Inneren Mariahilferstraße in zwei so genannte Begegnungszonen, welche in der Mitte zur Fußgängerzone wird, durch die dann aber doch der Linienbus durchmuss, ist einfach nur Stumpfsinn. Dieses Projekt kann nur scheitern. Und auch wenn die Grüne Maria Vassilakou nicht nur Vizebürgermeisterin, sondern auch Verkehrsstadträtin der Stadt Wien ist: Bürgermeister Michael Häupl persönlich möge nicht länger zu dieser unnützen Geldvernichtung schweigen, sondern dem unreifen Treiben auf Kosten der Steuerzahler, diesem im grünen Sandkasten entworfenen Luftschloss, durch ein Machtwort ein jähes Ende setzen. Danke.
Abschließend zum Vergleich noch die offizielle Infos der Stadt Wien zur Mariahilfer Straße neu:

1. FußgängerInnen-Zone auf der Mariahilfer Straße zwischen Kirchengasse und Andreasgasse
+ Das Liefern ist werktags von Montag bis Samstag zwischen 6 und 13 Uhr möglich.
2. Zwei Begegnungszonen zwischen Getreidemarkt und Kirchengasse sowie Andreasgasse und Kaiserstraße; Lieferzeiten und Lieferzonen bleiben unverändert.
+ Es gilt Tempo 20.
+ Drei “Kiss and Ride”-Plätze zum Ein- und Aussteigen wurden eingerichtet.
+ Zufahrten zu allen Garagen und Hauseinfahrten sind möglich.
3. Öffis und Taxis: Ein eigener Fahrbereich für den 13A wurde rot eingefärbt.
+Das Queren der Fahrbahn für den 13A ist erlaubt, das Längsgehen nicht.
+ Es gilt Tempo 20.
+ Taxis dürfen in Fahrtrichtung des Busses zum Abholen und Hinbringen die Fahrbahn des 13A benutzen. Das Ein- und Aussteigen erfolgt neben der markierten Fahrfläche. Das Durchfahren, ohne dort Ein-oder Aussteigen zu lassen, ist nicht erlaubt. Im Bereich der FußgängerInnen-Zone ist die Zu- und Abfahrt für Taxis zwischen 6 und 13 Uhr möglich.
+ Der Nachtbus N49 fährt seit 15. August nachts auf der Trasse der Straßenbahnlinie 49.
4. Radfahren ist in der gesamten Mariahilfer Straße in beiden Richtungen möglich.
+ Angepasste Geschwindigkeit, maximal Tempo 20 in den Begegnungszonen
+ FußgängerInnen-Zone: Schrittgeschwindigkeit, außer roter Fahrbereich für 13A: Dort Tempo 20 in Fahrtrichtung des Busses
+ Weitere Informationen: Radfahren auf der “neuen” Mariahilfer Straße – Fahrrad Wien
5. Das Parken in den betroffenen Bereichen der Mariahilfer Straße ist nicht mehr möglich.
+ Schaffung von AnwohnerInnen-Parkplätzen in den Seitengassen (je 27 AnwohnerInnen-Parkplätze im 6. und im 7. Bezirk). Ein weiterer Ausbau ist geplant.
+ Die umliegenden Garagen ermöglichen das Parken. Ausreichend Stellplätze sind vorhanden.
Nähere Infos der Grünen Stadtplanung zur Mariahilfer Straße neu gibts offiziell hier.
Ein Info-Folder ist hier downloadbar.
 Auch wenn sie im ehrwürdigen Theater an der Wien von Emmanuel Schikaneder (welcher auch das Libretto zur weltberühmten Oper schrieb) am 17. September 1791 uraufgeführt wurde, gehört sie inzwischen zum Standard-Repertoire beinahe jedes Opernhauses weltweit: „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Gerade diese über unzählige Generationen hindurch reichende Bekanntheit scheint es zu verunmöglichen, sie tatsächlich auf der Bühne neu in Szene zu setzen.
Auch wenn sie im ehrwürdigen Theater an der Wien von Emmanuel Schikaneder (welcher auch das Libretto zur weltberühmten Oper schrieb) am 17. September 1791 uraufgeführt wurde, gehört sie inzwischen zum Standard-Repertoire beinahe jedes Opernhauses weltweit: „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Gerade diese über unzählige Generationen hindurch reichende Bekanntheit scheint es zu verunmöglichen, sie tatsächlich auf der Bühne neu in Szene zu setzen. Der Tiroler Tenor Martin Mitterrutzner (Debut an der Volksoper) interpretiert Tamino -trotz seines jungen Alters mit noch weiterem Potential nach oben- mit einer Gänsehaut-erzeugenden und charmanten Leichtigkeit, in der er gar vielleicht bekannte so genannte Weltstars (bei denen ich teils schon beim Zuhören quälende Halsschmerzen verspüre) herausfordern könnte: da kommt hoffentlich in Zukunft noch viel Schönes und Erhebendes auf uns zu: so einen herausragenden „Tamino“ habe ich persönlich tatsächlich weder live noch auf Tonträgern gehört.
Der Tiroler Tenor Martin Mitterrutzner (Debut an der Volksoper) interpretiert Tamino -trotz seines jungen Alters mit noch weiterem Potential nach oben- mit einer Gänsehaut-erzeugenden und charmanten Leichtigkeit, in der er gar vielleicht bekannte so genannte Weltstars (bei denen ich teils schon beim Zuhören quälende Halsschmerzen verspüre) herausfordern könnte: da kommt hoffentlich in Zukunft noch viel Schönes und Erhebendes auf uns zu: so einen herausragenden „Tamino“ habe ich persönlich tatsächlich weder live noch auf Tonträgern gehört. Dieses zweifelhafte „Puppenspiel“, das die Handlung mehr stört als sie unterstützt, findet absolut keinen Zugang zu mir.
Dieses zweifelhafte „Puppenspiel“, das die Handlung mehr stört als sie unterstützt, findet absolut keinen Zugang zu mir.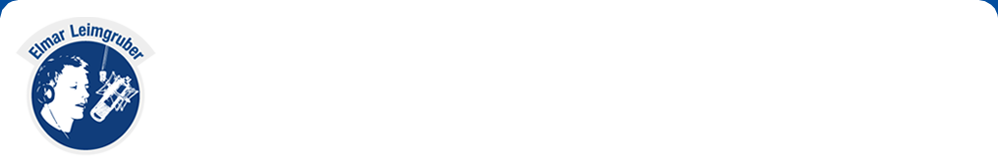













 W
W
















